Lebensgut
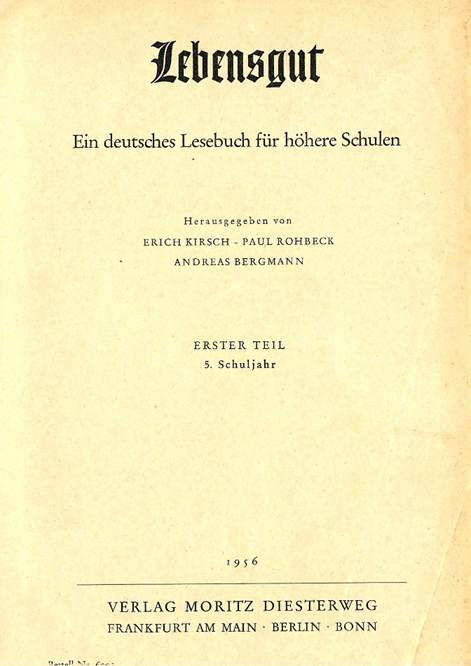
Lebensgut. Ein deutsches Lesebuch für höhere Schulen, herausgegeben von Erich Kirsch, Paul Rohbeck (1891-1970) und Andreas Bergmann, Erster Teil: 5. Schuljahr, Frankfurt am Main, Berlin und Bonn 1956.
Einführung
Der Deutschunterricht hat eine große Bedeutung. Es wird gelernt, sich in seiner Muttersprache verständlich sowie präzise auszudrücken, das kulturelle Erbe kennenzulernen, Gedanken abzuwägen und sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Die Literatur, welche an der Schule gelesen wird, hat einen Einfluß auf die Ausrichtung, Erziehung und Bildung junger Menschen. Von daher soll gefragt werden, wie das Lesebuch der Sexta aussah.
Der Titel war: „Lebensgut“. Es wurde 1956 in Frankfurt am Main, Berlin und Bonn herausgegeben von Erich Kirsch, Paul Rohbeck (1891-1970) und Andreas Bergmann.
Die Bebilderung war ansprechend: Es fanden sich Werke von Franz Marc, Frans Masereel, Emil Nolde, Pablo Picasso, außerdem Holzschnitte, sowohl europäische als auch japanische, und mittelalterliche Gemälde.
Themen waren im ersten Teil: Die Sorge und der Einsatz der Mutter für die Familie, ein Heimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft, ein schlechter Scherz, die Freigebigkeit und der Geiz, kindliche Streiche, denen die obligatorische Tracht Prügel folgte, Staunen über die Technik, Erlebnisse mit Tieren, Erzählungen über überstandene Gefahren, eine Erzählung über den Auftritt des achtjährigen Mozarts in London, Sagen, Märchen und Kurzweiliges: Baron von Münchhausen, Der tolle Bomberg und Till Eulenspiegel.
Der arme
und der reiche Bruder
Dieses Märchen von Ernst Wiechert (1887-1950) sei wegen seiner Länge hier in Kürze nacherzählt:
An einem stillen, dunklen Waldsee lebte ein Fischer mit seiner Frau. Sie waren sehr arm, deshalb gab es morgens, mittags und abends nichts anderes als Fischsuppe. Sie hatten zwei Söhne, die gegensätzlicher nicht sein konnten. Der ältere war immer geschäftig, er bog Angelhaken zurecht, schnitzte Pfeile und war unablässig am See oder in dem kleinen Gehöft tätig. Er hatte aber eine scharfe Zunge, rührte mißmutig in der Fischsuppe und beschwerte sich über die eintönige Speise. Seine Mutter gab ihm zu bedenken, daß manche Leute froh wären, wenn sie mittags Fischköpfe und Gräten hätten.
Der jüngere Sohn war andersgeartet. Er schnitzte sich eine Flöte, blies schöne Melodien und konnte abends gar nicht genug Märchen hören.
Eines Tages ließ der Vater die beiden im Wald etwas Holz für das Johannisfeuer am Sonnwendetag holen. Sie zogen den Leiterwagen, sammelten Holz und kamen schließlich an die Wolfsgruben, welche die Jäger angelegt hatten. Da hörten sie eine klagende Stimme und fanden einen alten Mann in einem merkwürdig geschnittenen Kleid, der beim Kräutersammeln in eine Wolfsgrube eingebrochen war. Er bat sie, ihnen ein Stäbchen mit einem Schlangenkopf zu geben, das sich oben befinden müsse. Der Jüngere fand es, doch der Ältere flüsterte ihm zu: „Laß dir etwas dafür versprechen!“. Der Jüngere schüttelte den Kopf und warf dem alten Mann das Stäbchen hinunter. Der nahm es und plötzlich lehnte am Rande der Grube eine Leiter. Der Alte stieg hinauf und sogleich verschwand die Leiter.
Den Kindern war es unheimlich zumute, doch der Alte blickte zuerst den älteren Bruder seltsam an und sagte schließlich, sie dürften sich etwas wünschen. Der Ältere wünschte sich, stets ein goldgelbes Brot zu haben, und der Jüngere, immer ein Märchen erzählen zu können. Der Alte blickte sie beide Male nachdenklich an, meinte aber schließlich, daß sich dies machen ließe. Darauf verschwand er.
Als die beiden Brüder größer geworden waren, ließen ihre Eltern sie in die Stadt ziehen, damit sie dort ihr Glück machten. Der Ältere ging bei einem reichen Bäcker in die Lehre, arbeitete erfolgreich und eröffnete schließlich seine eigene Bäckerei. Die Worte des Alten hielt er für baren Unsinn.
Der Jüngere wanderte ziellos durch die Straßen der Stadt. Er wunderte sich über ihre Pracht und Herrlichkeit. Am Abend kam er zu einem Spielplatz. Dort setzte er sich hin und erzählte ein Märchen nach dem anderen. Zuerst hörten ihm nur einige Kinder zu, dann wurden es immer mehr und schließlich lauschten auch ihre Eltern und Großeltern, die gekommen waren, um sie abzuholen. Als alle gegangen waren, kam eine alte Frau, führte ihn in ihr kleines Haus und behielt ihn bei sich. „Wer zu den Kindern kommt, der kommt von Gott“, sagte sie. Er half ihr in Haus und Garten, saß mit ihren Blumen und Früchten auf dem Markt und erzählte abends allen, die kamen, Märchen.
Nach einiger Zeit kam eine Hungersnot über das Land. Als der ältere Bruder das letzte Mehl aus dem Kasten gekratzt hatte und der jüngere das letzte Märchen erzählt hatte, das ihm in der hungrigen Nacht eingefallen war, sahen sie mitten unter den Menschen einen alten Mann, der ein merkwürdig geschnittenes Kleid trug und einen kleinen Stab mit Schlangenkopf in der Hand hatte. Er lächelte den beiden zu und verschwand.
Da sah der Ältere ein goldgelbes Brot auf dem Ladentisch liegen, und als er es weggegeben hatte, lag dort ein weiteres. Der Jüngere sah, wie an einer Perlenkette aufgereiht, eine lange Abfolge wunderbarer Märchen und fing gleich an, das erste zu erzählen.
Als sich die beiden wieder einmal trafen, fragte der Ältere, wer von ihnen der größere sei. Der Jüngere antwortete, daß sie beide Diener am Rechten wären und führte ihn zu einer baufälligen Hütte, in der ein Mädchen mit vor Elend durchsichtigem Gesicht und fiebrig glänzenden Augen auf einem Bette lag. Der Ältere schob ihr ein goldgelbes Brot hin, doch sie nahm es nicht, sondern bat den Jüngeren um ein Märchen.
Er begann, von dem Findelkind zu erzählen, das auf Erden nur Hunger, Not und Arbeit gekannt hatte. Da geleitete es ein Engel mit großen, silbernen Flügeln durch den dunklen Raum vor die Tore der Goldenen Stadt. Diese taten sich auf und der Glanz der Säle und Gärten strahlte in das eisige Dunkel hinaus. Der Klang der Zimbeln und Harfen ertönte zu dem geheimnisvollen Kreisen der Sterne. Die heilige Jungfrau stieg von ihrem Throne herab und ging dem Kind entgegen.
„Und, lächelte sie oder war sie traurig?“, flüsterte das Mädchen mit vergehender Stimme. „Sie lächelte“, sagte der Erzähler zärtlich. „Sie lächelte so, daß alle Knospen im Garten aufsprangen. Das Findelkind stand in einer goldenen Wolke, in der alle Tränen, die sie in ihrem Leben geweint hatte, wie Perlen hingen.“ – „Und dann?“, flüsterte das Kind. „Dann nahm es die Heilige Jungfrau an ihre Brust und kußte es.“ – „Und küßte es“, wiederholte das Mädchen, und dann streckten seine schmächtigen Glieder sich aus, und mit einem seligen Lächeln auf den Lippen entschlief es.
(Vgl. Märchen, mit Bildern von Hans Meid, 2 Bände, München 1946/1947; Lebensgut, 193-200).
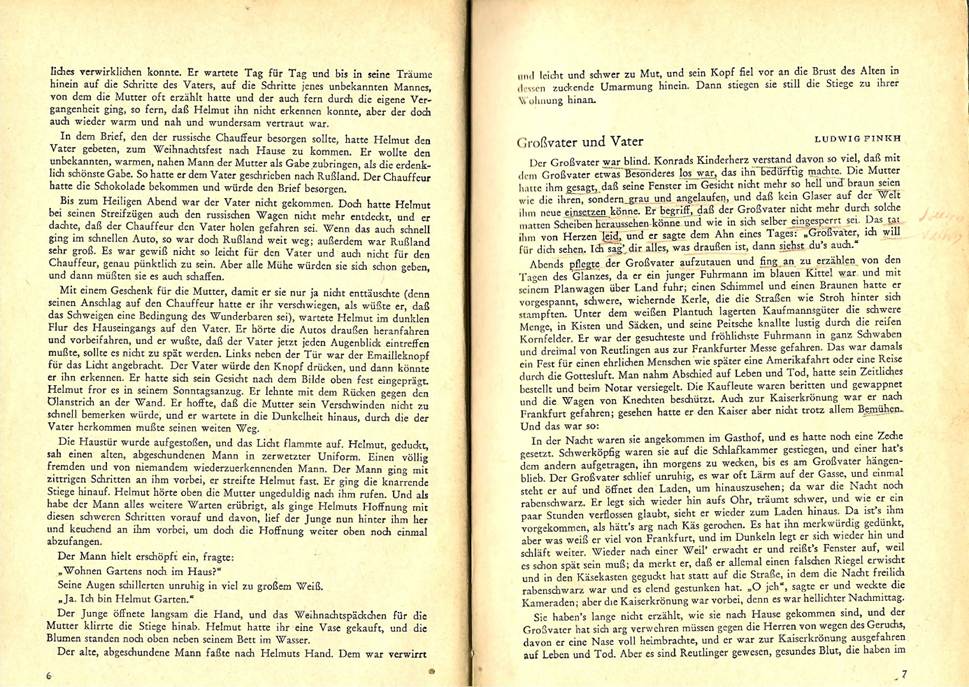
Rolf Schroers, Ein kleiner Junge schreibt nach Rußland, in: Lebensgut, Erster Teil, Seite 5f
Zitate
Herr von Ribbeck auf Ribbeck
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im
Havelland,
ein Birnbaum in seinem Garten stand.
Und kam die goldene Herbsteszeit
und die Birnen leuchteten weit und breit,
da stopfte, wennʼs
Mittag vom Turme scholl,
der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
und kam in Pantinen ein Junge daher,
so rief er: „Junge, wistʼne
Beer?“
Und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn,
kumm man röwer, ik hebʼ
ʼne Birn.“
So ging es viele Jahre, bis
lobesam
der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte sein Ende, ʼs
war Herbsteszeit
wieder lachten die Birnen weit und breit.
Da sagte von Ribbeck: „Ich
scheide nun ab,
legt mir eine Birne mit ins Grab!“
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
trugen von Ribbeck sie hinaus;
Alle Bauern und Büdner mit
Feiergesicht
sangen: „Jesus, meine Zuversicht“
und die Kinder klagten, das Herze schwer:
„He is dod nu. Wer giwt uns nu ne Beer?“
So klagten die Kinder. Das war
nicht recht;
ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht.
Der neue freilich, der knausert und spart,
hält Park und Birnbaum strenge verwahrt;
aber der alte, vorahnend schon
und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,
der wußte genau, was damals er tat,
als um eine Birnʼ
ins Grab er bat;
und im dritten Jahre aus dem stillen Haus
ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.
Und die Jahre gehen wohl auf und
ab,
längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
und in der goldenen Herbsteszeit
leuchtetʼs
wieder weit und breit.
Und kommt ein Jungʼ
überʼn
Kirchhof her,
so flüstertʼs
im Baume: „Wist ʼne
Beer?“
Und kommt ein Mädel, so flüstertʼs:
„Lütt Dirn,
kumm man röwer, ick gebʼ
di ʼne Birn.“
So spendet Segen noch immer die
Hand
des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
(Theodor Fontane, 1819-1898, Der Birnbaum an der Kirche zu
Ribbeck, in: Volkstümliches aus der Grafschaft Ruppin und Umgebung, Band I:
Sagen, herausgegeben von Karl Eduard Haase, Neu-Ruppin 1887, 112; in:
Lebensgut, Erster Teil, Frankfurt am Main 1956, 11f. Ein Büdner ist ein
Dorfbewohner ohne Feldbesitz. Er hat nur sein Haus und wird deswegen auch
Häusler genannt. Das Vorbild für Fontanes Figur war Hans Georg von Ribbeck,
1689-1759. Am 20. Februar 1911 wurde dieser Birnbaum von einem Sturme
umgeworfen. Sein Stumpf wurde in der Kirche von Ribbeck aufbewahrt. In den
1970er Jahren wurde ein Baum nachgepflanzt, der aber nicht, wie erhofft, trug,
daher erfolgte eine zweite Nachpflanzung im April 2000. Das Doppeldachhaus, das
heißt, mit Krüppelwalmdach, existierte zur Zeit des Hans Georg von Ribbeck noch
nicht.)
Im Schnee
verirrt
… Indessen brach die Nacht mit der in großen Höhen gewöhnlichen Schnelligkeit herein. Bald war es ringsherum finster, nur der Schnee leuchtete mit seinem bleichen Licht. Als die Kinder ein Felsentor fanden, setzten sie sich nieder. Der Knabe hatte erkannt, daß sie den Berg nicht mehr hinabgehen konnten, und legte die Tasche aus Kalbfell ab. Die zwei Weißbrote, welche die Großmutter eingewickelt hatte, nahm er aus dem Ränzchen und reichte beide der Schwester. Das Kind aß begierig. Es aß eines der Brote, von dem zweiten jedoch nur einen Teil. Den Rest reichte es Konrad. Er nahm das Stück und verzehrte es.
Nun saßen sie und schauten. Soweit sie in der Dämmerung zu sehen vermochten, lag überall der flimmernde Schnee, der in der Finsternis seltsam zu funkeln begann, als hätte er bei Tag das Licht eingesogen und gäbe es jetzt von sich. Der Schleier am Himmel fing an, sich zu verdünnen und zu verteilen, und die Kinder sahen ein Sternlein blitzen und konnten von ihrer Höhle aus die Schneehügel sehen, die sich in hellen Linien von dem dunklen Himmel abzeichneten. Weil es in der Höhle wärmer war, als es an jedem anderen Platze am ganzen Tage gewesen war, so ruhten sie eng aneinandergeschmiegt und betrachteten die Sterne, die sich nach und nach vermehrten. Hier kam einer, dort einer, bis es schien, als stehe am ganzen Himmel keine Wolke mehr.
Als eine lange Zeit vergangen war, sagte der Knabe: „Sanna, du mußt nicht schlafen. Der Vater hat gesagt: wenn man im Gebirge schläft, muß man erfrieren.“
„Ja, Konrad“, sagte das Mädchen.
Der Knabe hatte die Schwester am Zipfel ihres Kleides geschüttelt, um sie wachzuhalten. Als es nun aber wieder ganz stille war, empfand er nach einer Weile ein sanftes Drücken gegen seinen Arm, das immer schwerer wurde.
„Sanna, schlafe nicht, ich bitte dich, schlafe nicht“, sagte er.
„Nein“, lallte sie schlaftrunken, „ich schlafe nicht…“
(Adalbert Stifter, 1805-1868, Der Heilige Abend, in: Die Gegenwart. Politisch-literarisches Tagsblatt, Wien 1845; Bergkrystall, in: Bunte Steine. Pest und Leipzig 1853; in: Lebensgut, 30).

Blaues Band, Fachwerkhäuser in Horneburg, Photographie von H. M. Knechten
Er istʼs
Eduard Mörike
Frühling läßt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;
süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen. –
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bistʼs!
Dich habʼ ich
vernommen!
(Lebensgut, 114).
Weihnachten
Joseph von Eichendorff
Markt und Straßen stehʼn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend gehʼ ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kinder stehʼn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandʼre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heilʼges Schauern,
wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigtʼs
wie wunderbares Singen –
o du gnadenreiche Zeit!
(Lebensgut, 135f).
Der Franke
in Byzanz
Paul von Winterfeld (1872-1905; er edierte die Werke Hrotsvithas von Gandersheim, Hannover 1902)
Kaiser Karl, der Nimmermüde
Seiner Lande wohl bedachte,
Sandtʼ auch
einstmals einen Boten
Hin zum Hofe von Byzanz.
Dort empfing man ihn mit Ehren,
Setztʼ ihn an
des Kaisers Tafel,
Und ihm ward sein Platz gewiesen
Mitten in der Großen Kreis.
Nun war ein Gesetz gegeben,
An des Kaisers Tische dürfe
Niemand auf die andre Seite
Wenden, was ihm vorgelegt.
Doch der Franke, dieser Satzung
Unerfahren, wendetʼ
arglos
Seinen Fisch, der andern Seite
Ebenfalls ihr Recht zu tun.
Da erhoben sich die Fürsten
Mann für Mann, des Kaisers Ehre
Zu vertreten wider solche
Unerhörte Freveltat.
Und der Kaiser sprach mit
Seufzen:
„Zwar dein Leben ist verfallen;
Doch es steht vor deinem Ende
Dir noch eine Bitte frei.
Was es immer sei, ich will es
Dir gewähren.“ Und der Franke
Dachte nach und sprach bedächtig.
– Alles lauschte seinem Wort. –
„Eine kleine Bitte habʼ ich,
Eine einzʼge
nur, Herr Kaiser.“
Und der Kaiser sprach: „Wohlan denn,
Sprich: Sie ist voraus gewährt.
Nur das Leben dir zu schenken
Ginge gegen unsrer Väter
Altgeheiligte Bestimmung;
Jedes andre steht dir frei.“
Drauf der Franke: „Gerne sterbʼ ich,
Nur ein einziges begehrʼ
ich,
Ehʼ sie mich
zum Tode führen;
Wer den Fisch mich wenden sah,
Soll das Augenlicht verlieren.“
Und der Kaiser rief erschrocken:
„So mir Gott, die andern sagtenʼs,
Ich, ich habe nichts gesehn.“
Und die Kaiserin desgleichen:
„Bei der heilʼgen
Gottesmutter,
Bei der Königin des Himmels
Schwörʼ ich,
daß ich nichts gesehn.“
Und des Reiches Große schwuren
Bei den Fürsten der Apostel,
Bei der Engel und der Heilʼgen
Scharen,
Daß sie nichts gesehn.
Also schlug der schlaue Franke
Sie mit ihren eignen Waffen,
Und er kehrte wohl und munter
Wieder heim ins Frankenland.
(Lebensgut, 149f).

Et sapienter ad prelium (prœlium) – Und weise (klug) zur Schlacht, Reiterzug, Bildteppich von Bayeux, Lebensgut 155
Schwert und Pflug
Johann Ludwig Wilhelm Müller (1794-1827)
Einst war ein Graf, so geht die
Mär,
der fühlte, daß er sterbe;
die beiden Söhne rief er her,
zu teilen Habʼ
und Erbe.
Nach einem Pflug, nach einem
Schwert
rief da der alte Degen;
das brachten ihm die Söhne wert,
da gab er seinen Segen.
„Mein erster Sohn, mein
stärkster Sproß,
du sollst das Schwert behalten,
die Berge mit dem stolzen Schloß,
und aller Ehre walten.
Doch dir nicht minder, liebes
Kind,
dir sei der Pflug gegeben;
im Tal, wo stille Hütten sind,
dort magst du friedlich leben.“
So starb der lebensmüde Greis,
als er sein Gut vergeben;
die Söhne hielten sein Geheiß
treu durch ihr ganzes Leben.
Doch sprecht, was ward denn aus
dem Stahl,
dem Schlosse und dem Krieger?
Was ward denn aus dem stillen Tal
und aus dem schwachen Pflüger?
O fragt nicht nach der Sage
Ziel!
Euch kündenʼs
rings die Gauen:
Der Berg ist wüst, das Schloß zerfiel,
das Schwert ist längst zerhauen.
Doch liegt das Tal voll
Herrlichkeit
im lichten Sonnenschimmer;
da wächst und reift es weit und breit,
man ehrt den Pflug noch immer.
(Lebensgut, 171).

Franz Marc
(1880-1916), Blaues Pferdchen, Öl, Hanfstaengl-Druck (Lebensgut, nach Seite
176)
Marienfäden
Wilhelm Karl Raabe (1831-1910)
Als die Jungfrau Maria sterben wollte, so senkte sich eine rötliche, goldige Wolke vom Himmel herab; die umhüllte die Mutter Christi und hob sie leise vom Erdboden auf. Da stand die heilige Jungfrau plötzlich lebendig und jugendlich schön auf der Wolke in ihrem blauen Gewande, mit ihrem weißen Mantel, und langsam ward sie emporgetragen, dem Reiche Gottes zu.
Sie faltete die Hände auf der Brust und betete, und ihr Herz war voll Wonne. Unter ihr verschwand die grüne Erde, wo sie so viel Schmerz erduldet hatte; über ihr glänzte es schon in viel hellerem Glanz, als Sonne, Mond und alle Gestirne geben können. Das war die Herrlichkeit des Kindes, welches sie geboren hatte.
Höher und höher schwebte die Wolke, aber häßliche Geister lauerten an den Grenzen von Himmel und Erde; die waren plötzlich da und hängten sich an die heilige Wolke und zerrten und zogen daran, um sie zurückzuhalten in der Vergänglichkeit. Die Jungfrau stand ruhig, selig da; denn keiner der bösen Geister wagte es, sie selber zu berühren; nur das äußerste Zipfelchen ihres weißen Mantels streifte einer mit seinem schwarzen Flügel. Da sank der Mantel sofort von ihren Schultern und flatterte weit hinaus in die blaue Luft, und die häßlichen Geister jubelten und wollten ihn höhnend davontragen und ihren Spott damit treiben.
Aber die Winde, die Boten Gottes, kamen und litten es nicht; sie entrissen den heiligen, weißen Mantel den bösen Gewalten und führten ihn selber davon, hoch, hoch in die Lüfte. Da zerteilten sie ihn unter sich in unendlich viele und feine Fädchen; und wenn es nun Frühling wird auf der Erde, oder im Herbste, dann schweben diese Fädchen hernieder, flattern hin und her und glitzern auf den Feldern im Sonnenschein, und die Menschen nennen sie Marienfädchen. (Lebensgut, 184).
[Der Marienfaden ist ein Felder und Pflanzen überziehender oder in der
Luft schwirrender feiner Flugfaden, der von jungen Krabbenspinnen im Herbst in
die Luft geschossen wird, um an diesem ins Winterquartier zu gelangen.]

Frans Masereel (1889-1972), Der Erzähler, in: Mon livre dʼheures, Genf 1919; Mein Stundenbuch, München 1926; Mein Leben, 201; Lebensgut, 194
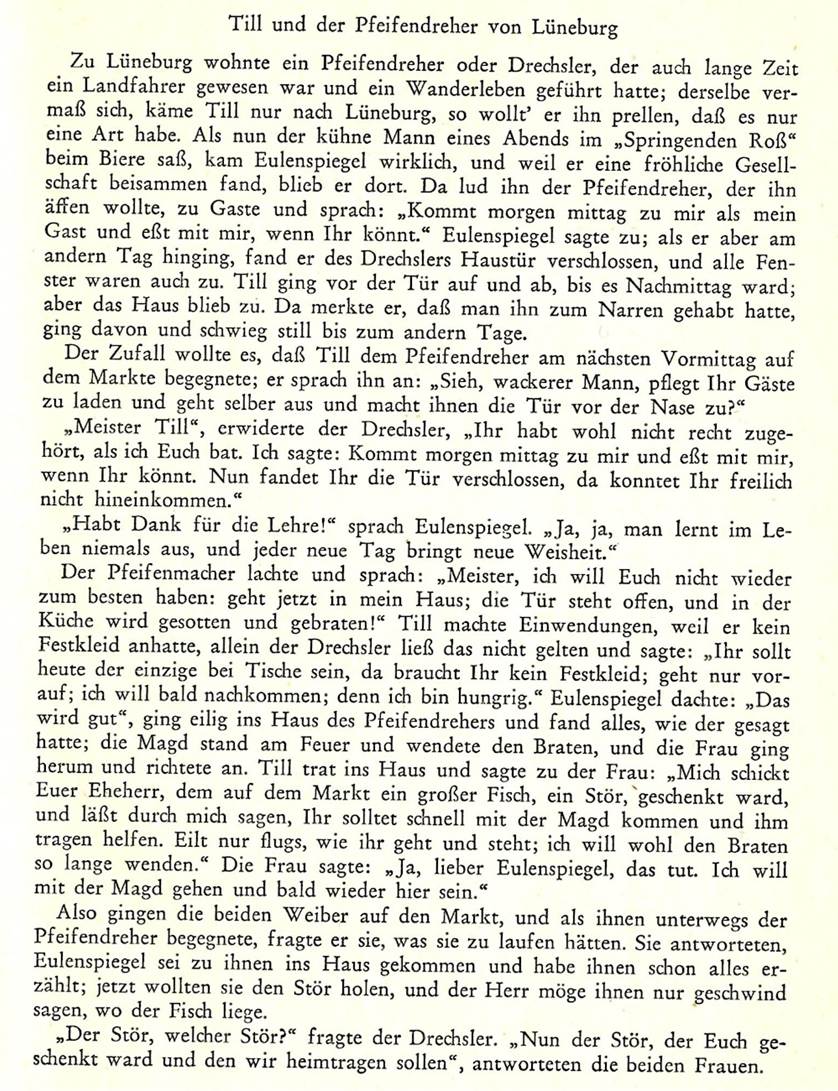
Till und der Pfeifendreher von Lüneburg, Teil 1, Lebensgut 225

Till und der Pfeifendreher von Lüneburg, Teil 2, Lebensgut 226; Sebastian Brant (1467/1458-1521), Das Narrenschiff, Basel 1494
© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2024